Jacques Poitou (Lyon)
1 Prototypentheorie(n)
1.1 Von kognitiven Kategorien zu semantischen Kategorien
Bevor wir uns der Anwendung der Prototypentheorie im Bereich der Flexionsmorphologie zuwenden, müssen wir uns mit der Frage befassen, was mit dem Begriff 'Prototyp' eigentlich gemeint ist. Dieser Terminus wird seit einigen Jahren so oft benutzt, dass es manchmal den Anschein hat, als wäre er ein bloßer Ersatz für herkömmliche Ausdrucksweisen. Eine Aussage wie "Diese Elemente weisen prototypisch das Merkmal M auf." scheint nicht selten die gleiche Bedeutung zu haben wie "Diese Elemente weisen in der Regel (d.h. letztendlich: meistens, aber nicht immer) das Merkmal M auf." Wenn dies zwar als eine Folge der Verbreitung (und des Erfolgs?) der Prototypentheorie gedeutet werden kann, so bleibt doch zu klären, wie der prototypische Charakter des Merkmals M für die betreffenden Elemente festgelegt werden kann und in welchem theoretischen Rahmen solche Aussagen sinnvoll sind. Daher scheint hier ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Prototypentheorie notwendig, wobei wir uns auf einige wesentliche Aspekte beschränken.
Bekanntlich hängt der Begriff 'Prototyp' mit der Frage der Kategorisierung zusammen, und seine gegenwärtige Verwendung in der Sprachwissenschaft geht eindeutig auf Arbeiten amerikanischer Psychologen - allen voran Eleanor Rosch[1] - zurück, denen es nicht um die Analyse der Sprache an sich ging, sondern um kognitive Denkprozesse, die man aber mittels sprachlicher Aussagen erfassen kann. In dieser Hinsicht ist es durchaus charakteristisch, dass die ersten Untersuchungen Roschs (1973) zur Frage der Kategorisierung der Farben bei einer Menschengemeinschaft (den Dani in Neuseeland) durchgeführt wurden, deren Sprache keine Wörter für die getesteten Farbbezeichnungen enthält.
Im Unterschied zu den herkömmlichen, aristotelischen Kategorisierungsprinzipien zeigten Roschs Untersuchungen u.a., dass die Elemente einer bestimmten Kategorie nicht alle denselben Status haben. Jede Kategorie besitzt eine innere Struktur, die sich kurz mit dem Begriff der Typikalität ausdrücken lässt. Einige Elemente sind für die Kategorie typischer als andere, und je mehr man sich von den zentralen, prototypischen, Elementen entfernt, desto mehr nähert man sich einem Bereich, wo die Zugehörigkeit zur Kategorie problematisch erscheint.
Ein weiterer bedeutender Unterschied zwischen der herkömmlichen Kategorisierung und der prototypischen Kategorisierung besteht darin, dass für erstere hinreichende und notwendige Bedingungen für die Kategorienzugehörigkeit angenommen wurden, während die prototypische Kategorisierung auf hinreichenden Bedingungen basiert. Um es kurz zu fassen: Es genügt, dass ein Element a eine gewisse Ähnlichkeit mit einem bereits kategorisierten Element b aufweist, um wie b kategorisiert zu werden (oder eher kategorisiert werden zu können). Wenn zum Beispiel ein Pinguin wie andere, in unseren Gegenden geläufigere Vögel einen Schnabel und einen mit Federn bedeckten Körper hat, kann er der Kategorie der Vögel zugerechnet werden. Kategorisierung beruht also auf Ähnlichkeitsbeziehungen. Diese "Familienähnlichkeit" (Wittgenstein)[2] kann aber auch zur Folge haben, dass zwei Elemente e1 und en derselben Kategorie keine gemeinsame Eigenschaft aufweisen: Es genügt, dass e1 einem anderen Element e2 irgendwie ähnlich ist, das wiederum einem dritten ähnlich ist, das en ähnlich ist.[3]
Soweit sich aber die kognitiven Denk- und Kategorisierungsprozesse in den sprachlichen Bezeichnungen widerspiegeln, ist es nicht verwunderlich, dass die ersten Ergebnisse der Arbeiten Roschs von Sprachwissenschaftlern wieder aufgegriffen wurden. Von kognitiv orientierten Analysen zu ihrer Anwendung in der linguistischen Semantik, und in erster Linie in der lexikalischen Semantik, war es nur ein kleiner Schritt: Die sprachlichen Bezeichnungen, die für die Psychologen ein Mittel waren, um an die kognitiven Prozesse heranzukommen, sind nun der Gegenstand der Analyse selbst. Wir können hier nur auf Kleibers (1990) Zusammenfassung hinweisen, der zwei Theorien unterscheidet, die "Standardtheorie", bei der jede Kategorie um einen prototypischen Kern organisiert ist, und die sogenannte "erweiterte Standardtheorie", in der die verschiedenen Kategorien sich überlappen. Die Struktur eines semantischen Bereichs erscheint dann als ein Bündel von miteinander verketteten Kategorien, deren Beziehungen auf einer "Familienähnlichkeit" beruhen (vgl. Poitou 2003).
In eigenen, neueren Untersuchungen zu einzelnen lexikalischen Kategorien (vgl. Poitou/Dubois 1999, Poitou 2000b, Dubois/Poitou 2002) haben wir zu zeigen versucht, dass die innere Struktur lexikalischer Kategorien noch viel komplexer ist. Ein sprachliches Zeichen besteht aus einer Inhaltsseite und einer Formseite, und die Detailanalyse einzelner Kategorien zeigt, dass die komplexe Gesamtstruktur einer lexikalischen Kategorie, wie sie in Tests erscheint, nicht nur durch die Merkmale der bezeichneten Gegenstände determiniert ist, sondern auch durch die morphologische und phonologische Form. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wenn Sprecher dazu aufgefordert werden, Elemente der Kategorie der Früchte aufzulisten, finden sich in einzelnen Listen hintereinander Wörter wie "Zitrone", "Mandarine", "Apfelsine" und "Nektarine". Wenn, wie angenommen, die Reihenfolge der genannten Wörter relevant ist, dann kann "Nektarine" nur mit der Form des vorhergehenden Worts in Verbindung gebracht werden. Die Gesamtstrukturierung einer Kategorie ergibt sich also aus verschiedenen parallelen Strukturen. Eine Typikalitätsskala, so wie sie in früheren Arbeiten zur prototypischen Kategorisierung angenommen wurde, kann diese Komplexität kaum erfassen. Sie kann zwar einen ersten Einblick in die innere Struktur von Kategorien verschaffen, sie verwischt aber deren Komplexität dadurch, dass sie alle Strukturen auf eine einzige Skala reduziert.
Soweit zu einigen - kurz gefassten! - Grundannahmen einer Prototypentheorie.
1.2 Prototypentheorie und Flexionsmorphologie
Im Bereich der Flexionsmorphologie wurde der Begriff der prototypischen Kategorisierung zum ersten Mal in einer bahnbrechenden Untersuchung von Bybee/Moder (1983; vgl. auch Bybee 1985 und Bybee 1988) zur Flexion der englischen starken Verben vom Typ "string-strung" angewandt, direkt in Anlehnung an Roschs Arbeiten. Das Ergebnis von Tests mit Kunstwörtern war folgendes: Die Produktion von starken Präterital- und Partizipialformen hängt von der phonologischen Struktur der Verbformen ab. Je mehr die Infinitivform der Struktur /sK(K)IN(K)/[4] ähnlich ist, desto häufiger wird das Verb stark flektiert (Präteritum und Partizip mit -u- als Stammvokal). Zum Beispiel wird für Kunstverben wie "sming" eine Präteritalform auf -u- von 44 Prozent der Sprecher gebildet und für "kib" von nur 7 Prozent. Diese phonologische Struktur wird also auf der Grundlage quantitativer Analysen mit Kunstwörtern festgelegt, und sie fungiert für die ganze Klasse als Prototyp. Die Struktur einer Flexionsklasse sieht dann so aus: In einem zentralen Bereich befinden sich die Elemente, die die als prototypisch festgelegten Eigenschaften aufweisen, und deren Flexionsformen auch stabil sind. Je mehr sich die phonologische Form der Wörter von diesem Prototyp unterscheidet, desto unstabiler sind auch deren Flexionsformen. Am Rande der Klasse befinden sich Elemente, deren Formen eher von anderen konkurrierenden Prototypen determiniert sind: In diesem konkreten Fall werden schwache Formen gebildet. Dabei ist der entscheidende Punkt die Korrelation zwischen der Verwandtschaft mit dem Prototyp und der Stabilität der Flexionsformen selbst.
Solchen Analysen liegt also das Prinzip der Motivierung der Flexionsformen durch Eigenschaften der lexikalischen Einheiten zugrunde; in Bybee/Moder (1983) ist es die phonologische Form, es könnten aber durchaus andere Eigenschaften sein: syntaktische (für das Verb z.B. der Status des Verbs im Satz - Vollverb vs. Hilfsverb, für das Substantiv das Genus), semantische oder auch pragmatische (Sprachebenen, Konnotationen, usw.).
Ein anderer wesentlicher Aspekt dieser Untersuchungen ist die Korrelation zwischen der Produktivität der Regeln und den lexikalischen Eigenschaften, die sie involvieren: "The productive and general rules are the most independent of the representations to which they apply, but as we go donw the scale, more and more information about particular representations are to be built into the rule." (Bybee 1988: 123). Dies hat zwei Folgen. Zum einen kann ein Flexionsbereich als ein komplexes hierarchisches Netz von Regeln (bzw. Prototypen) analysiert werden - von allgemeinen Regeln, die für den ganzen Bereich gelten, bis hin zu Regeln, die nur für ganz wenige Elemente gelten können. Zum zweiten bestehen zwischen den verschiedenen Elementen eines Bereichs lexikalische Relationen, die auf gemeinsamen phonologischen oder semantischen Eigenschaften beruhen, und die die Gesamtstruktur einer Flexionsklasse determinieren (vgl. dazu Bybee 1985: 117 ff. und Bybee 1988).
Ein Prototyp kann ganz allgemein als eine Relation zwischen Flexionsmerkmalen und anderen Merkmalen der lexikalischen Einheit (wir nennen sie fortan - in Anlehnung an Wurzel - "außermorphologisch"[5]) dargestellt werden:[6]
Mit dieser Relation, die auf einer hinreichenden Bedingung basiert, kann die "Familienähnlichkeit" dargestellt werden: Eine gemeinsame außermorphologische Eigenschaft genügt für die Annahme eines Flexionsmerkmals des einen Elements durch ein anderes, was aber prinzipiell nie obligatorisch ist.
Dynamisch betrachtet, fungiert der Prototyp als eine Art Anziehungspol. Der potentielle Anziehungsbereich des Prototyps besteht genau aus den Elementen, die dieselbe(n) außermorphologische(n) Eigenschaft(en) aufweisen. Die potentiellen Anziehungsbereiche zweier Prototypen können sich prinzipiell überschneiden, was zur Folge hat, dass die Flexionsformen eines Elements zwischen der einen und der anderen Flexionsklasse schwanken können.
Die relative Anziehungskraft eines Prototyps hängt von quantitativen und qualitativen Faktoren ab: (i) je mehr Elemente dieselbe außermorphologische und dieselbe morphologische Eigenschaft aufweisen, desto größer ist die Anziehungskraft des entsprechenden Prototyps, (ii) je mehr Elemente dieselbe außermorphologische Eigenschaft aufweisen (also je größer der Anziehungsbereich des entsprechenden Prototyps ist), desto größer ist auch seine potentielle Anziehungskraft, (iii) die Qualität der in Betracht kommenden außermorphologischen Eigenschaften ist zweifellos auch relevant (vgl. dazu 3.2).[7]
Wenn wir nun einen Schritt weiter gehen, so kann wegen der Vielfalt der Eigenschaften der lexikalischen Einheiten die Struktur von Flexionsbereichen auch eine sehr komplexe sein. Prinzipiell strukturiert jede Eigenschaft den betreffenden Bereich: Substantive kann man nach Genus, nach den verschiedenen Merkmalen der phonologischen Form (Einsilbigkeit vs. Mehrsilbigkeit, Anlaut, Auslaut, Stammvokal, usw.) und natürlich auch nach semantischen Merkmalen kategorisieren. Dieselbe Problematik gilt auch für die Analyse der Flexion selbst und die daraus folgende Definition der Flexionsklassen.[8] Im Bereich des deutschen Substantivs z.B. kann man als Flexionsklasse die Menge der Elemente definieren, deren Flexionsmerkmale alle dieselben sind, oder die nur eines von ihnen aufweisen. Insbesondere fragt es sich, ob Kasus- und Numerusflexion zusammen genommen oder getrennt werden müssen.
Gehen wir noch einen Schritt weiter, dann kann eine prototypische Struktur nicht nur für große Kategorien angenommen werden, sondern auch für Unterkategorien, die nur aus ganz wenigen Elementen bestehen können. Die Relevanz kleiner Kategorien ist an sich keine große Entdeckung: Im Altgermanischen (und auch immer noch im Isländischen) galt (gilt) einer der Flexionstypen ausschließlich für Verwandtschaftsnamen mit einer besonderen phonologischen Form - die Bezeichnungen für "Vater", "Mutter", "Tochter", "Bruder" und "Schwester". Theoretisch kann ein Prototyp für eine Klasse angenommen werden, die nur aus zwei Elementen besteht. Wenn wir einen Prototyp dynamisch als Anziehungspol verstehen, kann der potentielle Anziehungsbereich entweder auf ganz wenige Elemente beschränkt sein, oder sehr breit sein oder auch erweiterbar durch Bildung neuer Wörter mit derselben Eigenschaft. A contrario kann für ein Unikum wie die Ind.-Präs.-Formen von 'sein' wohl kaum ein Prototyp angenommen werden, insofern als kein anderes Verb dieselben lexikalischen, phonologischen und syntaktischen Eigenschaften besitzt.
Ob es relevant ist, Prototypen mit kleinem Anziehungsbereich anzunehmen, ist natürlich eine andere Frage, die nur auf der Grundlage empirischer Analysen gelöst werden kann. Da man in jeder Wissenschaft grundsätzlich nach maximaler Generalisierung strebt, hängt die Antwort davon ab, ob man den Fakten Rechnung tragen kann, wenn man nur Prototypen mit breitem Anziehungsbereich annimmt. Wir gehen davon aus, dass die Annahme von Prototypen in zwei Fällen begründet sein kann:
1. Diachrone Daten oder synchrone Daten wie Sprachfehler (oder auch experimentelle Untersuchungen) zeigen, dass ein Flexionsmerkmal für neue Wörter gelten kann, für die es bisher nicht galt, d.h. die entsprechende Flexionsklasse ist erweiterbar (Kriterium der Produktivität).
2. Eine produktive Flexionsklasse umfasst Elemente mit einer besonderen außermorphologischen Eigenschaft. Für Elemente mit der selben außermorphologischen Eigenschaft, die aber andere Flexionsmerkmale aufweisen, können Prototypen angenommen werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: (i) diese Elemente oder Untergruppen dieser Elemente weisen gemeinsame außermorphologische Eigenschaften auf und (ii) die Stabilität der entsprechenden Flexionsmerkmale kann nicht mit einer hohen token-Frequenz erklärt werden.
Ein Beispiel. Für die deutsche Substantivflexion gilt auf jeden Fall folgender Prototyp:
(Die entsprechenden Feminina weisen nur zwei Formen auf, eine im Singular und eine im Plural; Beispiel: Sing. Frau, Pl. Frauen; Sing. Lampe, Pl. Lampen)
Von der Gültigkeit dieses Prototyps zeugen zahlreiche Fakten: diachrone Entwicklungen (viele Feminina mit anderen Flexionsformen sind zu dieser Flexionsklasse übergegangen), heutige Produktivität (die meisten fem. Neubildungen weisen diese Flexionsmerkmale auf).
Man könnte sich mit diesem Prototyp begnügen, wenn alle Feminina zu dieser Flexionsklasse zählten. Dem ist aber nicht so, und sofern es einige Ausnahmen gibt, sind andere Prototypen unerlässlich: z.B. kann für die fem. und neutralen Wörter auf -nis protoj angenommen werden:
Dieser Prototyp ist im Bereich der Neutra eine besondere Variante eines allgemeineren Prototyps:
Um die Gültigkeit dieser Hypothesen zu überprüfen, wollen wir einige Teilbereiche der deutschen Substantivflexion untersuchen, die sich dafür um so besser eignet, als sie sehr komplex zu sein scheint und als sie bereits in vielen wissenschaftlichen Arbeiten und im Lichte unterschiedlicher Theorien behandelt worden ist.
2 Drei Fallstudien im Bereich der deutschen Substantivflexion
2.1 Strukturierung der Klasse der schwachen Maskulina
In der deutschen Gegenwartssprache bilden die sogenannten "schwachen Maskulina" eine Flexionsklasse, die dadurch charakterisiert ist, dass im ganzen Paradigma außer im Nom. Sing. eine Form auf -(e)n (Bote, Boten; Herr, Herr(e)n) gilt.
Zu den schwachen Maskulina zählen in der Gegenwartssprache vier Gruppen von Substantiven:
(2) zwei- und mehrsilbige auf -e (Junge, Matrose), auch alle[9] belebt
(3) mehrsilbige mit Fremdsuffixen (bzw. Endungen fremder Herkunft) und Endbetonung (Optimist, Soldat, Komet),
(4) mehrsilbige mit Penultimabetonung (Ungar, Augur,[10] usw.).
Die erste Gruppe umfasst nur eine begrenzte Anzahl von Substantiven, für die die Pluralform wesentlich stabiler zu sein scheint als die Singularformen, die mehr oder weniger im Abbau begriffen sind, wenn auch eher zugunsten einer suffixlosen Form als zugunsten der starken Flexion.[11] Noch weniger vertreten ist die vierte Gruppe, die nur wenige, schwankende Wörter enthält. Dagegen sind die Gruppen 2 und 3 durchaus produktiv, sofern ihr Bestand erweiterungsfähig ist - sei es durch Übernahme von Wörtern aus anderen Sprachen oder (vor allem) wegen der Produktivität der zugrunde liegenden Wortbildungsmuster.
Die außergewöhnliche Entwicklung dieser Klasse ist schon oft untersucht worden (vgl. u.a. Bittner 1991, Poitou 1992: II-94 ff., Köpcke 1995 und 2000), wobei eines der Probleme, auf das wir uns hier beschränken, die innere Struktur der Klasse ist. Es wird allgemein anerkannt, dass mindestens drei Merkmale bei der Klassenzugehörigkeit eine Rolle spielen: das maskuline Genus, das semantische Merkmal der Belebtheit und die phonologische Struktur, für die (mindestens) zwei Varianten angenommen werden, die den zwei produktiven Gruppen entsprechen: (i) Mehrsilbigkeit, auslautendes Schwa und Penultimabetonung, (ii) Mehrsilbigkeit und Endbetonung (vgl. Bittner 1991: 134, Köpcke 1995: 168 ff., Köpcke 2000: 107 ff.). Wir können diese Hypothesen mit folgenden Prototypen interpretieren:
proto2: [[+mehrsilbig], [+Endbetonung], [+mask.], [+belebt]] & schwache Flexion
Für eine solche Analyse spricht eine Reihe von quantitativen und historischen Fakten: Was die Motivierung der Klasse durch das Genus betrifft, so hat sich der Geltungsbereich der schwachen Flexion seit dem Mittelhochdeutschen auf Maskulina reduziert. Belebt sind auch gegenwärtig die meisten schwachen Maskulina, und die unbelebten Substantive, die im Mhd. schwach waren, sind zu anderen Flexionstypen übergegangen (vgl. unter vielen anderen Glaube, Knospe, …; detaillierte Analysen u.a. in Poitou 1992: II-96 ff., Köpcke 2000).
Wenn dem so ist, sollte die Flexion der Substantive, die die genannten außermorphologischen Eigenschaften nicht aufweisen, nicht stabil sein, und diese Substantive sollten also zu anderen Flexionstypen übergehen können.
Fakt ist aber, dass die dritte Gruppe (Optimist, Soldat, Komet) sehr bunt zu sein scheint. Sie setzt sich aus vielen Untergruppen zusammen, die sich in ihrem quantitativen Bestand, in ihrer Produktivität und in Bezug auf das Merkmal der Belebtheit unterscheiden. A priori kann proto2 für die ganze Gruppe nur dann gelten, wenn sich alle Untergruppen gleich verhalten, d.h., wenn die entsprechenden Flexionsformen gleich stabil sind für Substantive, die die genannten außermorphologischen Eigenschaften aufweisen und mehr oder weniger instabil, wenn einige dieser Eigenschaften fehlen. Dabei ist hier der entscheidende Punkt das Merkmal der Belebtheit.
Zuerst einige Fakten zu vier dieser Untergruppen.
- Substantive auf -ist (Optimist…): alle belebt, das zugrunde liegende Wortbildungsmuster ist durchaus produktiv, und ihre Flexion scheint keiner Schwankung ausgesetzt zu sein.
- Substantive auf -graph (Geograph, Paragraph): Es sind (bis auf "Paragraph") entweder nomina agentis oder nomina instrumenti, das Wortbildungsmuster ist auch produktiv, wenn auch weniger, die schwachen Formen sind resistent sowohl für belebte als für unbelebte, jedoch mehr im Plural, wo starke Formen so gut wie nie vorkommen, als im Singular, wo für Unbelebte starke Gen.-Formen belegt sind, wenn auch mit einer token-Frequenz von weniger als drei Prozent.
- Substantive auf Vokal+t: belebte und unbelebte Maskulina (Rekrut, Soldat, Satellit, Komet, Astronaut); den schwachen Maskulina, ob belebt (Soldat) oder unbelebt (Komet), stehen unbelebte starke Maskulina (Salat, Granit) und Neutra (Zertifikat, Dekret) gegenüber, was einige Schwankungen zugunsten starker Flexionsformen[12] (vor allem im Singular) begünstigen kann: Im Pl. kommt "die Magnete" doppelt so häufig vor wie "die Magneten", während "des Magneten" zehnmal häufiger belegt ist als "des Magnets".
- Substantive auf -end/-and/-ant/-ent (Abiturient, Demonstrant, Dividend, Doktorand, Quotient, Konsonant, Multiplikand): eine noch kompliziertere Reihe, bei der zwischen den einzelnen Endungen genauer unterschieden werden muss. Bei den wenigen, unbelebten, Wörtern auf -end, die alle zum semantischen Feld der Mathematik gehören, ist die schwache Flexion resistent. Zu den Wörtern auf -and zählen sowohl belebte als unbelebte Substantive (Doktorand, Multiplikand), für die nur schwache Formen belegt sind. Bei den Wörtern auf -ant erhält sich die schwache Flexion auch,[13] außer bei "Diamant", bei dem schwache Formen überwiegen, wenn auch mehr im Pl. als im Sing. Den schwachen Maskulina auf -ent (belebte - Abiturient - und unbelebte - Koeffizient, Quotient) stehen starke Mask. (Kontinent, Moment) und Neutra (Kompliment, Testament) gegenüber; zwar sind einige starke Gen.-Sing.-Formen (des Quotients) belegt, aber nur in weniger als einem Prozent der Belege (vgl. Poitou 1992: II-124-126).
Aus dieser Beispielreihe, die sich fortsetzen ließe, ergeben sich zwei Schlussfolgerungen:
1. Dass sich die schwache Flexion bei belebten Substantiven erhält, steht eindeutig fest, die Annahme von proto2 ist also berechtigt.
2. Das Hauptproblem betrifft die Kategorie der unbelebten schwachen Maskulina, bei der man unseres Erachtens nicht pauschal von "massiven Abbautendenzen" (Köpcke 1995) sprechen dürfte, weil sie nicht so massiv belegt zu sein scheinen und vor allem weil sich die einzelnen Gruppen in dieser Hinsicht nicht gleich verhalten. Für die Erklärung der Fakten reicht also ein einziger Prototyp nicht aus. Wenn auch ein solcher Prototyp absolut unerlässlich ist, um zu erklären, warum alle unbelebten Maskulina auf -e zu anderen Flexionsklassen übergegangen sind, beweist die Verschiedenheit der einzelnen Gruppen innerhalb der schwachen mask. Fremdwörter, dass hier eine Reihe von anderen Prototypen wirksam sind, deren Wirkungsbereich zwar auf wenige Wörter beschränkt sein kann, ohne die aber die Erhaltung der schwachen Flexion unerklärt bleibt. Zum Beispiel können wir für die wenigen Substantive auf -end von einem Prototyp proto3 ausgehen, der etwa so aussehen könnte:
Dieser Prototyp könnte, wie jeder andere auch, als Anziehungspol für andere Wörter fungieren, falls es welche gäbe oder falls neue Wörter mit denselben phonologischen Merkmalen gebildet werden sollten - was nicht der Fall ist. Zu bemerken ist noch, dass das Merkmal "Mathematik" auch für unbelebte Substantive auf -and (Multiplikand), -ant (Quadrant) und -ent (Quotient) gelten kann.
Es kann hier nicht unser Anliegen sein, die ganze Klasse der schwachen Maskulina zu analysieren und deren Gesamtstruktur zu erarbeiten. Aus diesem Beispiel wird aber ersichtlich, dass sich Prototypen, mit denen breite Bereiche analysiert werden können, als nicht genügend erweisen, um das Flexionsverhalten von Wörtern in kleineren Teilbereichen zu erklären. Selbst wenn schwache Maskulina fremder Herkunft mehrheitlich belebt sind, beweisen Detailuntersuchungen, dass schwache Flexionsformen auch bei einigen Gruppen von unbelebten Substantiven stabil sein können, was mit Hilfe von Prototypen mit beschränktem Anziehungsbereich erklärt werden kann. Dabei bleibt es ein Ziel der wissenschaftlichen Untersuchung, selbst in Teilbereichen mit beschränktem Inventar Prototypen anzunehmen, die für den größtmöglichen Anziehungsbereich gelten können und die also mehr oder weniger übergreifende außermorphologische Eigenschaften involvieren.
2.2 Struktur der Reste der Klasse der femininen i-Stämme
Die Klasse der Feminina mit umgelautetem e-Plural (Hand, Pl. Hände) geht auf die Klasse der ehemaligen i-Stämme zurück, die sowohl Maskulina als Feminina enthielt. Während aber eine kompakte Gruppe von mehreren hundert Maskulina diese Pluralform beibehalten haben, besteht die Klasse der Feminina mit umgelautetem e-Plural nur noch aus weniger als 40 Substantiven, während die meisten zur großen femininen Klasse mit (e)n-Plural übergegangen sind. Der Vorteil dieses Flexionstyps war eine einfache Numerusunterscheidung in allen Kasus mit nur zwei Formen (Sing. Lampe, Pl. Lampen). Gerade deshalb ist es besonders interessant zu untersuchen, durch welche Faktoren der "Konservatismus" dieser wenigen Wörter motiviert sein kann. Es sind die, die man traditionell als "Ausnahmen" bezeichnet, und es fragt sich, ob ihre Flexionsformen anderen Motivierungsfaktoren unterliegen als Flexionsformen, die für große Klassen gelten und schließlich, ob die Zweiteilung eines Flexionsbereichs in reguläre und irreguläre Formen berechtigt ist (vgl. zu dieser Problematik Poitou 1990, 1997).
Ein erster Erklärungsweg ist eine quantitative Analyse. Es ist oft bemerkt worden, dass hochfrequente Formen konservativer sein können als weniger frequente (der Indikativ Präsens des Verbs "sein" ist in vielen Sprachen ein gutes Beispiel dafür) - was mit der Funktionsweise des Gedächtnisses zusammenhängt. Fakt ist aber (und dazu ist keine genaue quantitative Analyse nötig), dass neben hochfrequenten Wortformen (Hand, Stadt, Frucht, usw.) andere seltenere (Feuersbrunst...) bestehen. Wenn eine hohe token-Frequenz zum Widerstand von Wortformen gegen Neuerungen beitragen kann, so darf dieser Faktor aber nicht überbewertet werden.
Wir gehen von der Hypothese aus, dass hier ähnliche Faktoren am Werk sein können wie bei anderen, großen Klassen auch: entweder die Kopplung der Flexionsformen an die phonologische Form oder an den lexikalischen Inhalt. Es ist bereits bemerkt worden (vgl. u.a. Poitou 1990, Poitou 1992: II-155 ff., Köpcke 1993: 124 ff.), dass sich die phonologische Form, die bei diesen Substantiven am meisten vertreten ist, durch folgende Merkmale auszeichnet:
(2) dentaler Verschlusslaut im Auslaut: 29 - andere Konsonanten: /k/ 1, /s/ 4, /r/ 1, kein Konsonant 2;
(3) Konsonantencluster im Auslaut: VKKK 9, VKK 17, VK 9, V 2
(4) /U/ + V(K)+ /t/: 7
Der umgelautete e-Plural erhält sich nur bei Substantiven mit umlautfähigem Vokal, (wenn man von Wörtern auf -nis absieht, denen andere Prototypen zugrunde liegen). Feminina mit nicht-umlautfähigem Vokal sind auf verschiedene Weise in die en-Klasse übergegangen: ohne Veränderung der Singularform (Geiß), Annahme einer Singularform auf -e (Leiche), umgelauteter Stammvokal im ganzen Paradigma (Tür) und Singularform auf -e und umgelauteter Stammvokal (Hüfte).[14]
Insgesamt könnten diese phonologischen Merkmale als Indiz eines einzigen Prototyps analysiert werden - im Sinne der Untersuchungen von Bybee/Moder (1983) zu den englischen starken Verben. Eine solche Analyse lässt aber einen Punkt im Dunkeln: Wie ist dann zu erklären, weshalb Substantive, die sich in einigen Merkmalen von der als Prototyp angenommenen phonologischen Form unterscheiden, den e-Plural beibehalten haben und keiner Schwankung ausgesetzt zu sein scheinen: vgl. Schnur, Nuss, Kuh, Laus, Maus, ...
In diesem Bereich wie in dem der schwachen Maskulina erweist sich die Annahme eines einzigen Prototyps als ungenügend. Daher erscheint auch hier eine genauere Analyse einzelner Untergruppen von Wörtern als sinnvoll, die bis auf den Anlaut genau dieselbe phonologische Struktur haben. Und da nicht bewiesen ist, dass die Pluralform (im Unterschied zur Kasusflexion) strikt vom Genus determiniert ist, müssen wir auch Maskulina und Neutra in Betracht ziehen. Nachfolgend geben wir exemplarisch einige dieser Untergruppen[15] wieder, um die Relevanz dieser Verfahrensweise auf die Probe zu stellen.
| Fem | Mask./Ntr. | alle Genera | |||
| Plural -e + U | Plural -en | Plural -e/-er + U | Plural ohne U | Pl. ungebräuchlich | |
| K+/and/ | Hand, Wand | Band, Brand, Land, Stand, Strand, Pfand, Rand |
|||
| K+/Us/ | Nuss | Guss, Schuss, Fluss, Schluss |
Verdruss[16] | ||
| K+/Uxt/ | Frucht, Sucht, Zucht, Flucht |
Bucht (17. Jh.) | |||
| K+/axt/ | Macht, Nacht, Schacht | Vollmacht, Jacht (16. Jh.), Fracht (16. Jh.), Andacht (ahd. anathâht), Gracht (18. Jh.), Tracht (ahd. trahta), Schlacht (ahd. slaht, slahta), Vollmacht |
Schacht | ||
| K+/aNk/ | Bank, | Bank (15. Jh.) | Schrank, Schank | Dank, Zank | |
| K+/aUs/ | Laus, Maus | Haus, Daus (auch ohne U) | |||
| K+/a:t/ | Naht | Tat, Saat | Staat (15.Jh) | ||
| K+/o:t/ | Not | Schlot (auch mit U), Schrot, Brot, Boot, Lot |
Kot | ||
Für jede dieser Untergruppen kann man - als eine erste Hypothese - einen Prototyp annehmen, dessen potentieller Anziehungsbereich maximal die Wörter der jeweiligen Gruppe umfasst, also sehr klein bleibt:
Für einige Gruppen (K+/and/, /aUs/, /Us/) ist die umgelautete Pluralform (sei es mit -e oder auch mit -er bei Neutra) konkurrenzlos. Interessanterweise sind es Formen, die von der dominierenden phonologischen Struktur abweichen: Die Erhaltung einer umgelauteten Pluralform für ein bestimmtes Wort begünstigt die Erhaltung derselben Form für andere, was mit dem entsprechenden Prototyp zusammengefasst werden kann. Bei anderen Gruppen (K+ /axt/, /aNk/, /Uxt/) bestehen konkurrierende Pluralformen, die aber durch den Zeitpunkt der Aufnahme ins Deutsche erklärt werden können: "Bucht", "Bank" (Pl. Banken), "Jacht", "Tracht", "Gracht" wurden alle in nhd. Zeit aufgenommen, und die Tatsache, dass keines dieser Wörter zu dieser Flexionsklasse übergegangen ist, zeigt (was nicht gerade verwunderlich ist), dass ihre Anziehungskraft gegenüber der großen fem. Klasse mit en-Plural zu gering war, um neue Feminina anzuziehen (im Gegensatz zu den Maskulina). Das heißt, dass hier das Femininum - im Unterschied zum Maskulinum - die Anziehungskraft der angenommenen Prototypen einschränkt: Sie sind sozusagen stark genug, um einige Verluste zugunsten des en-Plurals zu verhindern, aber nicht stark genug, um neue Wörter anzuziehen. Im Falle von "Schlacht" sind im Ahd. zwei Grundformen belegt, von denen die eine (slahta) den en-Plural nur favorisieren konnte. - Für die Pluralformen von "Andacht", "Tat" und "Saat", sowie für die /o:t/-Reihe sehen wir keine Erklärung.
Fazit: Wenn auch nicht alle Fakten eine befriedigende Erklärung finden können (was mit der geringen Extension der einzelnen Reihen zusammenhängt), so erweist sich diese Verfahrensweise unseres Erachtens als fruchtbar.
1. Die diachronen und synchronen Daten (die anhand experimenteller Untersuchungen überprüft werden könnten) zeigen, dass solche "Ausnahmen" nur im Rahmen eines größeren Bereichs sinnvoll analysiert werden können: Auf diachroner Ebene erweist sich ihr Bestand als nicht erweiterbar, weil für alle Feminina ein Prototyp (Pl. auf -(e)n) gilt, dessen Anziehungskraft stärker ist als die einzelner Prototypen, die für diese kleinen Untergruppen gelten können.
2. Sofern die Stabilität des umgelauteten e-Plurals auf synchroner Ebene nicht mit quantitativen Verhältnissen erklärt werden kann, bietet die Annahme einzelner Prototypen für jede dieser Untergruppen eine mögliche Erklärung.
3. Solche Prototypen sind aber auch nicht isoliert voneinander zu betrachten: Einige dieser Reihen besitzen gemeinsame phonologische Eigenschaften: denselben Auslaut /xt/ in den Gruppen auf /axt/ und /Uxt/, denselben Stammvokal /U/ in mehreren Gruppen, usw. Wenn man all diese Eigenschaften in Betracht zieht, ergibt sich ein komplexes Netz von einander überschneidenden und miteinander verketteten Subkategorien, und es ist wohl anzunehmen, dass die mannigfaltigen Relationen zwischen den einzelnen Untergruppen dieser Flexionsklasse auch zu ihrer Stabilität beitragen.
4. Andererseits scheinen uns Ausnahmefälle, wie umgelautete Pluralformen im Rahmen der Feminina, prinzipiell nicht anders motiviert zu sein als reguläre Fälle: Für große Klassen, für kleine Klassen und selbst für Einzelfälle können also Prototypen angenommen werden, die außermorphologische und morphologische Merkmale involvieren. Unterschiede zwischen Ausnahmen und Regularitäten sind dann anderswo zu suchen: im Umfang und in der Erweiterbarkeit der potentiellen Geltungsbereiche der entsprechenden Prototypen und in der Art und Weise, wie die betreffenden Formen gespeichert bzw. konstruiert werden - was maßgeblich durch deren Frequenz determiniert ist (vgl. dazu Poitou 1997).
2.3 Erweiterung des Anwendungsbereichs des er-Plurals
Die dritte Untersuchung betrifft die Klasse der Substantive mit er-Plural - als Beispiel für die Erweiterung einer in alter Zeit sehr kleinen Flexionsklasse, die sich trotz starker Konkurrenz anderer Flexionstypen nach und nach ausdehnte und dann - ab Ende des 18. Jh. - wieder abgebaut wurde.
In früher ahd. Zeit bestand diese Klasse aus nur wenigen Neutra, die zum semantischen Feld der Landwirtschaft und der Viehzucht gehörten. Diesem Flexionstyp standen bei den Neutra zwei andere gegenüber: die schwache Flexion (n-Stämme), die bei den Neutra nur schwach vertreten war, und die starke Flexion (a-Stämme), die im Ahd. dadurch gekennzeichnet war, dass im Nom. und Akk. die gleiche Form für Sing. und Pl. bestand. Vgl. die drei Paradigmen im Althochdeutschen:
| ir-Stamm | a-Stamm | n-Stamm | ||
| Sing. | Nom./Akk. | lamb | wort | hërza |
| Gen. | lambes | wortes | hërzen | |
| Dat. | lambe | worte | hërzen | |
| Pl. | Nom./Akk. | lembir | wort | hërzun |
| Gen. | lembiro | worto | hërzono | |
| Dat. | lembirum | wortum | hërzôm |
Für die Erweiterung der er-Klasse auf Kosten der Klasse der a-Stämme werden in der Literatur Erklärungen angeboten, die bei unterschiedlichen theoretischen Ansätzen mit der Frage der Numerusunterscheidung zusammenhängen (vgl. u.a. Bojunga 1890, Gürtler 1913, auch Wurzel 1984, Köpcke 1993: 139 ff.). Der er-Plural sei ein praktisches Mittel gewesen, um Sing. und Pl. distinkt zu symbolisieren, was die Flexion der a-Stämme mit ihren ambigen Nom.- und Akk-Formen nicht leisten konnte. Gegen eine solche Erklärung ist prinzipiell nichts einzuwenden: Im Bereich der Morphologie basieren Sprachveränderungen auf der Übernahme von neuen Formen durch die Gemeinschaft der Sprecher, und die Sprecher bilden diese neuen, "fehlerhaften" Formen, weil sie die alten nicht beherrschen oder um Problemen zu entgehen, die der Sprache innewohnen (vgl. Poitou 2000a). Ambiguität kann ein solches Problem sein, und dies um so mehr als die Numerusunterscheidung in früher Zeit weniger durch syntaktische Mittel symbolisiert wurde als in der Gegenwartssprache. Die Numerusunterscheidung durch die Form des Substantivs selbst galt auch, zumindest im Nom., für die meisten anderen Flexionstypen.
Begnügen wir uns aber mit dieser Erklärung, stoßen wir gleich auf drei Probleme: (i) warum setzte sich dann der er-Plural bei Neutra nicht allgemein durch (wie der en-Pl. bei Feminina, bei denen auch das Problem der Numerusunterscheidung bestand), und warum blieben bis ins Mhd. bei den a-Stämmen nicht distinkte Nom.-/Akk.-Formen erhalten? (ii) warum dehnte sich diese Pluralform weiter aus in einer Zeit, wo die Pluralform der neutralen a-Stämme der der mask. a-Stämme angeglichen wurde (Nom./Akk.Pl. wort > Worte) - und dies bereits ab mhd. Zeit? (iii) wenn der er-Plural ein so praktisches Mittel zur Numerusunterscheidung war, warum ging er dann ab Ende des 18. Jh. drastisch zurück? (Auf diese dritte Frage gehen wir hier nicht ein.)
Wenn man die Entwicklung des er-Plurals global betrachtet, kann man verschiedene Stufen unterscheiden, die einander folgen, selbst wenn man hier schwer von einer strikt chronologischen Folge sprechen kann. Wir verfügen nur über lückenhafte (und nur schriftliche) Daten, andererseits kommen Sprachveränderungen nie von einem Tag auf den anderen zustande: Zwischen dem Zeitpunkt, wo eine neue Form zum ersten Mal schriftlich belegt ist, und dem Zeitpunkt, wo die alte Form nicht mehr vorkommt, vergehen manchmal Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte. Jedenfalls sieht die Entwicklung, so wie man sie global rekonstruieren kann, so aus:
- Stufe 2: Bereits im Ahd. wird der er-Plural für andere einsilbige starke Neutra übernommen, unabhängig von ihrem lexikalischen Inhalt (nhd. Kind, Weib, Geld).
- Stufe 3: Ab mhd. Zeit wird er auch für einsilbige starke Maskulina angenommen (nhd. Gott, Wald, Mann).
- Stufe 4: Ab nhd. Zeit wird er für fremde, mehrsilbige Neutra angenommen (Regiment, Spital).
- Stufe 4': Unabhängig von Stufe 4 gilt er auch - wenn auch mit besonderen Konnotationen - für ein Femininum (ein paar Märker…)
Wenn in Stufe 1 diese Pluralform an phonologische (Einsilbigkeit), syntaktische (Neutrum) und semantische Eigenschaften gekoppelt ist und dadurch motiviert sein kann, so beweist der Übergang von Stufe 1 zu Stufe 2, dass nur zwei dieser Eigenschaften genügten, um die Annahme des er-Plurals zu motivieren. Mit anderen Worten: Genügte in Stufe 1 ein einziger Prototyp proto1, um den Fakten Rechnung zu tragen, kommt in Stufe 2 ein zweiter, proto2, hinzu, der den ersten nicht ersetzt, sondern eher erweitert.Der Anziehungsbereich von proto2 schließt den von proto1 ein.
proto2 [[Einsilbigkeit] + [Neutrum]] & er-Plural
Für die anderen Entwicklungsstufen kann man auf gleiche Weise folgende Prototypen annehmen:
proto4 [[Neutrum]] & er-Plural
proto4' [[Einsilbigkeit]] & er-Plural
Hier liegt also ein allmählicher Demotivierungsprozess vor, der im wesentlichen dadurch charakterisiert ist, dass jeder Prototyp dem vorherigen bis auf ein Merkmal ähnlich ist. All diese Prototypen konkurrieren auch mit anderen - worauf wir hier nicht eingehen können -, sonst wäre der er-Plural die einzige zulässige Form für Einsilbige und Neutra geworden.
Eine solche Ausdehnung eines Pluralmarkers auf immer breitere Bereiche kann unseres Erachtens nicht ausschließlich mit Problemen erklärt werden, die sich aus den Charakteristiken eines gegebenen Sprachzustands ergeben. Das Problem der Numerusunterscheidung mag bei der Ausdehnung des er-Plurals bei Neutra die Rolle eines Auslösers gespielt haben. Diese Erklärung kann aber für deren Übernahme bei Maskulina nicht gelten, bei denen Sing. und Pl. ja distinkt waren. Es müssen andere Gründe vorliegen, an die man nur dadurch herankommen kann, dass man die Entwicklung der einzelnen Formen im Detail verfolgt, soweit das sich auf der Grundlage der vorhandenen Daten machen lässt: Wir stützen uns hierbei vor allem auf Gürtlers (1913: 125, 135, 177, 217) Daten und einzelne Analysen und beschränken uns exemplarisch auf einige Maskulina.
In früher ahd. Zeit war "got" Neutrum, daraus entstand das Kompositum "abgot", das den er-Plural annahm, während das Simplex "got" (wohl aus semantischen Gründen) zu den Maskulina überging. Ab dem 12. Jh. galt der er-Plural auch für "got" - also die Übernahme der Pluralform des Kompositums für das Simplex. Ebenfalls ab dem 12. Jh. ist der er-Plural für mask. "geist" belegt - in diesem Fall kann die semantische Verwandtschaft zwischen "Gott" und "Geist" die Übernahme des er-Plurals ausgelöst haben. Ab dem 16. Jh. erscheint der er-Plural auch für "leib"; diese Neuerung kann entweder durch die semantische Verwandtschaft (Antonymie) mit "Geist" motiviert sein, oder auch durch die phonologische Ähnlichkeit mit dem Neutrum "weib" (er-Plural ab dem 15. Jh.).
Ähnlich kann im Falle von "wald" (er-Plural erst im 17. Jh.) die semantische Verwandtschaft mit den Neutra "gras", "blat", "krût", "holz", "loub" mitgewirkt haben.
Zwar ist ein solcher Rekonstruktionsversuch höchst hypothetisch (wenn auch nicht neu). Es sind ad-hoc-Erklärungen, die keine Generalisierung (und daher auch keine Widerlegung) zulassen. Wir betrachten aber diese Hypothesen insofern als plausibel, als sie dem allgemeinen Prinzip der prototypischen Organisation der Flexionsformen entsprechen. Grundbedingung für die Annahme einer neuen Flexionsform für ein bestimmtes Wort ist, dass es in seinen phonologischen, syntaktischen oder semantischen Merkmalen einem anderen ähnlich ist, das diese Flexionsform bereits aufweist. Mit anderen Worten: Jedes Wort kann als Prototyp für andere Wörter fungieren. Die Übernahme eines Flexionsmerkmals für eine Gruppe von Wörtern kann und muss im allgemeinen Rahmen des ganzen Bereichs analysiert werden, aber auch im Rahmen einzelner Teilbereiche, in verschiedenen Untergruppen und gegebenenfalls wie hier gezeigt, im Rahmen einzelner Wortpaare. Der Gesamtprozess gilt ja nicht nur für Klassen, sondern auch für einzelne Wörter, und dem muss der Sprachwissenschaftler Rechnung tragen und versuchen, auch dafür plausible Erklärungen zu geben.
3 Struktur der Flexionsklassen
Wie diese drei Fallstudien zeigen, ergibt sich aus solchen Analysen eine viel komplexere Struktur der Flexionsklassen als bisher angenommen. Grundsätzlich basiert die Definition - und daher auch die Extension - der Kategorien und Unterkategorien auf zwei Typen von Merkmalen: Flexionsmerkmale und außermorphologische Eigenschaften.
3.1 Zu den Grenzen einer Flexionsklasse
Wenn ein Sprecher eine Form produziert, ordnet sich diese Form in eine bestimmte Klasse ein (z.B. gehört "Magnet" nicht zur selben Flexionsklasse (oder zumindest nicht zur selben Pluralklasse), je nachdem ob als Pluralform "Magneten" oder "Magnete" gebildet wird). Auf dieser Ebene sind also die Grenzen einer Klasse alles andere als unscharf. Eine sogenannte Unschärfe erscheint erst auf einer anderen Ebene, wenn unter den verschiedenen Äußerungen desselben Sprechers oder einer Gruppe von Sprechern unterschiedliche Formen für dieselbe lexikalische Einheit und dieselben grammatikalischen Werte vorkommen. Genauer betrachtet heißt das, dass die Zuordnung eines Worts zu einer Flexionsklasse schwankt und dass dasselbe Wort also bald zu der einen und bald zu der anderen Klasse gehört. Es wäre unseres Erachtens angemessener zu sagen, dass eine (morphologisch definierte) Flexionsklasse strikt aus den Elementen besteht, die die entsprechenden Flexionsmerkmale aufweisen. Und innerhalb dieser Klasse kann man die Elemente nach der token-Frequenz der belegten Flexionsformen einordnen, also auf einer Art Stabilitätsskala: an dem einen Pol sind die betreffenden Flexionsformen stabil, am anderen Pol werden sie am seltensten realisiert (zugunsten anderer Formen, die das betreffende Element in eine andere Flexionsklasse einordnen).
3.2 Morphologische Klassen und lexikalische Kategorien
Nun entsteht der Eindruck der Unschärfe der Grenzen von Klassen nicht nur wegen der Schwankungen im Gebrauch, sondern auch deshalb, weil zwischen morphologischen Klassen und lexikalischen Kategorien keine 1:1-Entsprechung besteht und Eigenschaften unterschiedlicher Art zur Motivierung der Flexionsformen beitragen können.
Grundsätzlich gilt Folgendes: Wenn sich Elemente des potentiellen Anziehungsbereichs eines Prototyps protoi den in diesem Prototyp festgelegten Flexionsmerkmalen entziehen, dann deshalb, weil (i) sie zum potentiellen Anziehungsbereich eines anderen Prototyps protoj gehören und (ii) weil protoj stärker ist als protoi und sich dessen Anziehungskraft sozusagen widersetzt. Damit wird gleich die grundlegende Frage aufgeworfen, weshalb bestimmte Prototypen stärker sind als andere. Es wirken dabei ganz sicher sehr unterschiedliche Faktoren mit, auf die wir hier nur kurz verweisen können. (i) Bestimmte außermorphologische Eigenschaften scheinen besser als andere in der Lage zu sein, einen morphologischen Bereich zu strukturieren und zu motivieren, weil sie größere Bereiche umfassen - wie im Deutschen das Genus (jedes Substantiv kann einem der drei Genera zugerechnet werden); dagegen scheint die Qualität des Auslauts als strukturierende Eigenschaft wegen der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Phoneme weniger leistungsfähig. (ii) Morphophonologische Eigenschaften scheinen leistungsfähiger als semantische (sie sind auch leichter erkennbar und die Flexion besteht in einer Änderung der Form). (iii) Offensichtlich sind auch die leistungsfähigsten semantischen Eigenschaften diejenigen, die für einen breiten Bereich gelten und binär fungieren (z.B. [± belebt]). (iv) Zweifellos spielt die Frequenz (genauer gesagt die token-Frequenz) insofern eine entscheidende Rolle, als sie die kognitiven Mechanismen beeinflusst: Je mehr ein bestimmter Prototyp aktiviert wird, um so unmittelbarer steht er für weitere Kategorisierungsprozesse zur Verfügung. Für die Geltung dieser vier Faktoren lassen sich in komplexen Bereichen leicht Evidenzen finden - und auch genügend Gegenbeispiele, die nur beweisen, dass diese Frage noch weiterer Untersuchungen bedarf...
4 Dynamik der Kategorisierungsprozesse und innere Struktur der Flexionsklassen
Diesen Grundannahmen entspricht die Dynamik der Kategorien, wie sie von den Sprechern gehandhabt werden.
4.1 Aktivierung bestimmter Prototypen und Stabilisierung der Kategorien
Wenn das zu kategorisierende Element bereits kategorisiert worden ist, beruht dessen erneute Kategorisierung auf der Aktivierung eines bereits bestehenden Prototyps, was zur Stabilisierung und Verstärkung der entsprechenden Kategorie führt. Daraus ergeben sich die Nützlichkeit der quantitativen Analysen und die zugrunde liegende übliche Annahme einer Korrelation zwischen Frequenz und Memorisierung.
4.2 Demotivierung der Klassenzugehörigkeit
Die Demotivierung einer Flexionsklasse, oder eines Teils einer Flexionsklasse, und daher auch die Erweiterung ihres Umfangs, ist eine mögliche Konsequenz der Art und Weise, wie der Sprecher ein Element einer Kategorie zuweist.
Nehmen wir an, für die Kategorie PROTO0 gilt in einer ersten Etappe "proto0 = [lexi, lexj] & m", wobei lexi, lexj, usw. außermorphologische Eigenschaften bezeichnen und m ein Flexionsmerkmal.
Da für die Kategorisierung in PROTO0 nur hinreichende Bedingungen genügen, kann ein Element, das die Eigenschaft lexi besitzt, nicht aber lexj, das Flexionsmerkmal m annehmen. Dies bedeutet eine Erweiterung der ursprünglichen Kategorie, der ein neuer Prototyp proto1 zugrunde liegt:
Wenn sich ein solcher Demotivierungsprozess fortsetzt, entsteht eine Klasse mit konzentrischer Struktur: um einen Kern, der dem ersten Stadium der Kategorisierung entspricht, bilden sich mehrere Ringe. Die in 2.3 analysierte Klasse der Substantive mit -er Plural ist ein gutes Beispiel für eine solche Struktur.
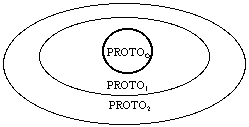
4.3 Remotivierung der Klassenzugehörigkeit
Umgekehrt tritt Remotivierung ein, wenn die außermorphologischen Eigenschaften, die einem Prototyp zugrunde liegen, für dieselbe Flexionsklasse durch andere ersetzt werden.
Nehmen wir zwei Elemente
an, e1 und e2  PROTO0,
und der Kategorie PROTO0 liegt der Prototyp "proto0 =
[lexi] & m" zugrunde. Nehmen wir weiter an, e2 hat
auch die Eigenschaft [lexj]. Es sei nun ein drittes Element e3,
das lexj und lexk besitzt, nicht aber lexi.
Wenn für e3 das Merkmal m angenommen wird, heißt es, dass
eine Reanalyse der Kategorie PROTO0 stattgefunden hat. Zumindest
in einem Teil der Klasse wird proto0 durch proto1 = [lexj]
& m ersetzt. Dieser Prozess kann sich fortsetzen, wenn andere Elemente,
die nur lexk aufweisen, wie e3 kategorisiert werden.
PROTO0,
und der Kategorie PROTO0 liegt der Prototyp "proto0 =
[lexi] & m" zugrunde. Nehmen wir weiter an, e2 hat
auch die Eigenschaft [lexj]. Es sei nun ein drittes Element e3,
das lexj und lexk besitzt, nicht aber lexi.
Wenn für e3 das Merkmal m angenommen wird, heißt es, dass
eine Reanalyse der Kategorie PROTO0 stattgefunden hat. Zumindest
in einem Teil der Klasse wird proto0 durch proto1 = [lexj]
& m ersetzt. Dieser Prozess kann sich fortsetzen, wenn andere Elemente,
die nur lexk aufweisen, wie e3 kategorisiert werden.
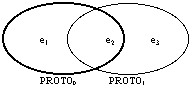
Ein typisches Beispiel dafür ist im Rahmen der deutschen Substantivflexion die Ausdehnung der Klasse der sogenannten schwachen Maskulina ab mittelhocheutscher Zeit. Galt sie im frühen Mittelhochdeutschen vornehmlich für zweisilbige Maskulina auf -e, die Lebewesen bezeichneten (herre), so wurde dieser Flexionstyp nach und nach für längere Wörter verwendet, die zwar nicht mehr zweisilbig waren, aber die beiden Merkmale "belebt" und "Endung auf -e" aufwiesen (evangeliste, alchimiste) und außerdem Fremdwörter waren. Durch Apokopierung verschwand die e-Endung (> Evangelist), was die Ausdehnung der schwachen Flexion auf andere Fremdwörter, die Lebewesen bezeichneten, bewirkt, und auf andere Fremdwörter mit derselben Endung (vgl. Poet, Planet; Konkurrent, Koeffizient, usw.). Daher die Entwicklung einer Flexionsklasse mit innerer Kettenstruktur.
4.4 Typologie der inneren Struktur der Flexionsklassen
So komplex die innere Struktur einer nach diesen Prinzipien entstandenen Kategorie auch sein mag, so gilt auf jeden Fall, dass jedes Element mindestens eine gemeinsame außermorphologische Eigenschaft mit mindestens einem anderen Element besitzt. Diese Eigenschaft fungiert bei der Kategorisierung als hinreichende Bedingung. Je nachdem, wie komplex die innere Struktur der Flexionsklasse erscheint, kann man verschiedene Typen unterscheiden.
(1) Homogene Klassen liegen vor, wenn einer Flexionsklasse ein einziger Prototyp zugrunde liegt, d.h. wenn alle Elemente, die ein bestimmtes morphologisches Merkmal besitzen, auch dieselbe(n) außermorphologische(n) Eigenschaft(en) aufweisen. Beispiele dafür lassen sich im Deutschen nur mit Mühe finden (in der Verbflexion gelten einzelne Formen für alle Verben, z.B. 2. Person Sing. im Ind. und Konj. auf -st). Im Französischen kann man an die Konjugation der Verben der "ersten Gruppe" denken, die im Infinitiv alle auf -er (/e/) enden (aimer).
(2) Einen zweiten Typ bilden Klassen mit konzentrischer Struktur, in denen sowohl der Kern als auch jeder Ring bis in die Peripherie homogen ist.
(3) Einen dritten Typ bilden die konzentrischen Klassen mit homogenem Kern und heterogener Peripherie. Sie entstehen durch Demotivierung (ggf. auch durch Remotivierung) nach unterschiedlichen Richtungen. Ein gutes Beispiel bildet die dritte Klasse der starken Verben im Englischen, sowie sie von Bybee/Moder (1983) analysiert wurde. Der Kern der Klasse besteht aus Verben wie "string" (strung, strung), die die prototypische phonologische Struktur /sK(K)IN(K)/ haben. Die Peripherie der Klasse setzt sich aus mehreren Unterkategorien zusammen, die ein Merkmal oder mehrere weniger haben als die prototypische Struktur (und deren Elemente stärker von anderen Flexionstypen angezogen werden als die des prototypischen Kerns); je mehr sich die phonologische Struktur eines Verbs mit der des Prototyps deckt, um so mehr neigt der Sprecher dazu, starke Formen auf -u- für Präteritum und Partizip zu bilden.
(4) Den vierten Typ bilden die Klassen mit polyzentrischer Struktur. Die Klasse der schwachen Maskulina ist ein hervorragendes Beispiel dafür; vgl. folgende Abbildung:
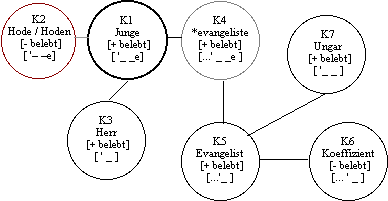
Einige Erklärungen zu den einzelnen Unterkategorien. Im Mittelhochdeutschen umfasste diese Flexionsklasse (abgesehen von einigen wenigen Fremdwörtern) hauptsächlich Wörter der Unterklassen K1 und K2, das Merkmal der Belebtheit war also morphologisch nicht relevant. Alle Unbelebten derselben phonologischen Form wurden aus der Klasse ausgestoßen. Schwankend ist immer noch "Hode", aber sowohl in der Flexion (Gen. Sing.) als im Genus und in der Grundform. Aus K1 entstand durch Apokope K3. Abgesehen von K4-K7 bestand die Flexionsklasse fortan aus zwei Unterklassen, deren gemeinsame Motivierung in der semantischen Eigenschaft lag. Dieselbe Eigenschaft ist auch das Bindeglied zwischen K1 und K4 - und sie motivierte die schwache Flexion von zahlreichen auf -e endenden, belebten Fremdwörtern. K5 und K4 unterscheiden sich nur durch das Fehlen des Schwas in K5, K5 und K6 durch das Kriterium der Belebtheit, K5 und K7 durch die Betonung. Diese Globalanalyse gilt für den gegenwärtigen Stand der schwachen Maskulina, und sie müsste durch eine viel feinere Analyse der einzelnen Untergruppen erweitert werden (vgl. 2.1). Interessant daran ist aber, dass ein Bindeglied, K4, fehlt, das wohl in der Erweiterung dieser Klasse eine entscheidende Rolle gespielt hat (vgl. dazu u.a. Bittner 1991 und Köpcke 1995). Für K1, K3, K5 und die kaum belegte Kategorie K7 gilt aber dasselbe Merkmal der Belebtheit, sonst hätten wir - was prinzipiell nicht auszuschließen ist - eine gebrochene Kette. Für die ganze Klasse gilt auch eine gemeinsame phonologische Eigenschaft: Die flektierten Formen sind (außer "Herrn") auf der vorletzten Silbe betont (vgl. Herren, Jungen, Evangelisten, Koeffizienten, Ungarn).
5 Fazit
Mit diesen Analysen und Überlegungen hoffen wir gezeigt zu haben, dass die Prototypentheorie ein fruchtbarer theoretischer Ansatz für morphologische Analysen sein kann: Morphologische Klassen erscheinen als spezifische Ergebnisse allgemeiner kognitiver Prozesse, und dies sowohl in einem gegebenen Sprachzustand als auch in ihrer Dynamik, d.h. in ihrer diachronen Dimension. Aber vor allem scheint die Prototypentheorie, so wie wir sie hier skizziert haben, ein angemessenes Mittel zu sein, um die herkömmliche Unterscheidung zwischen regulären und irregulären Formen (bzw. natürlich vs. markiert) dadurch zu überwinden, dass alle morphologischen Formen prinzipiell gleichermaßen mit Prototypen analysiert und erklärt werden können. Der grundlegende Unterschied zwischen Regularitäten und Ausnahmen ist kein qualitativer, sondern ein quantitativer Unterschied. Sicher ergeben sich daraus zwei Konsequenzen: Zum einen werden häufig belegte Formen anders gespeichert und demzufolge anders produziert als seltenere. Zum zweiten erschwert die quantitativ geringe Anzahl der "Ausnahmen" die Arbeit des Forschers in erheblichem Maße. Er kann oft nur über spärliches empirisches Material verfügen, insbesondere, wenn die zu untersuchenden Formen nicht häufig vorkommen. Die Hypothesen, die er für seltene Formen erarbeiten kann, können zwar nicht immer überprüft werden, es sind aber plausible Hypothesen, wenn sie mit anderen allgemeineren Hypothesen kompatibel sind, und sie sind unseres Erachtens unerlässlich, wenn man ganze Reihen von sprachlichen Daten nicht unerklärt lassen will.
Anmerkungen
* Für wertvolle Kommentare und Anregungen bedanke ich mich bei D. Dubois, B. Coudurier und bei den zwei anonymen Gutachtern. [zurück]
1 Vgl. unter vielen anderen Arbeiten zu diesem Thema Rosch 1973, 1975, Kleiber 1990, Dubois 1991, Taylor 1995, Mangasser-Wahl 2000. [zurück]
2 "wir haben ein komplexes Netz von Ähnlichkeiten vor uns, die einander überdecken und überschneiden: manchmal durchgehende Ähnlichkeiten, manchmal Detail-Ähnlichkeiten. Es fällt mir kein treffenderer Ausdruck ein, um diese Ähnlichkeiten zu bezeichnen als 'Familienähnlichkeit'" (Wittgenstein in Taylor 1995: 39) [zurück]
3 Bei allen theoretischen Unterschieden erinnert der Begriff der Familienähnlichkeit an die junggrammatische Analogie, die auch, im Unterschied zu den phonetischen Gesetzen, als ein psychologischer Prozess verstanden wurde. Pauls bekannte Proportionengleichungen beruhen auf der gegenseitigen Attraktion der Wörter: "[die einzelnen Wörter] attrahieren sich […] in der Seele, und es entstehen dadurch eine Menge größerer oder kleinerer Gruppen. Die gegenseitige Attraktion beruht immer auf einer partiellen Übereinstimmung des Lautes oder der Bedeutung oder des Lautes und der Bedeutung zugleich. Die einzelnen Gruppen laufen nicht allein gesondert neben einander her, sondern es gibt größere Gruppen, die mehrere kleinere in sich schließen, und es findet eine gegenseitige Durchkreuzung der Gruppen statt." (Paul 1937: 106) Einer der Hauptunterschiede zwischen der junggrammatischen Analogie und der Prototypentheorie besteht nun darin, dass sich die junggrammatische Analogie an sich nicht als eine Theorie der Struktur der Kategorien versteht, sondern nur als eine Theorie der Produktion von Wörtern durch den einzelnen Sprecher. Zu Recht bemerkt Paul, dass sich diese psychischen Prozesse "in Einzelgeistern [vollziehen] und nirgendwo sonst". Und weil sie psychische Prozesse sind, unterliegen Analogiebildungen für Junggrammatiker mehr oder weniger dem Zufall: Analogiebildungen sind für die Junggrammatiker grundsätzlich durch kein Gesetz determiniert. - Vgl. zur Bewertung der junggrammatischen Theorie im Lichte neuer Theorien u.a. Wurzel 1988, Poitou 1992: I-174 ff. [zurück]
4 Für alle phonologischen Umschriften benutzen wir die SAMPA-Umschrift. [zurück]
5 Außermorphologische Eigenschaften schließen auch Eigenschaften ein, die mit der Wortbildung zu tun haben. [zurück]
6 Dieses Prinzip entspricht in gewissem Sinne dem von Wurzel 1984 (vgl. auch Wurzel 1994) ausgearbeiteten fruchtbaren Prinzip der Kopplung morphologischer Eigenschaften an außermorphologische. Die hier dargelegte Prototypentheorie unterscheidet sich von Wurzels Arbeiten (denen wir viele Anregungen verdanken) in verschiedenen Punkten, vor allem in der Gesamtmodellierung eines Flexionsbereichs. Wurzels Prinzip der Systemangemessenheit und die damit verbundenen Paradigmenstrukturbedingungen (PSB) gelten für einen ganzen Bereich oder für große Teilbereiche (z.B. Maskulina, Feminina, usw.) und führen (abgesehen von wenigen "irregulären" Formen) zu einer radikalen Zweiteilung der Flexionsformen in "natürliche" (oder "unmarkierte") und "markierte"; für letztere muss in den Lexikoneinträgen ein Merkmal spezifiziert werden, das eine PSB blockiert und eine andere Flexionsform erzeugt. Im Unterschied dazu gehen wir davon aus, dass die Produktion von Flexionsformen, ob "markiert" oder "unmarkiert", nicht grundlegend anders ist - abgesehen davon, dass unterschiedliche token-Frequenzen der Formen bei deren Memorisierung, bei deren Speicherung und also bei deren Produktion eine entscheidende Rolle spielen. [zurück]
7 Dasselbe gilt für semantische Kategorien; vgl. dazu u.a. Poitou 2000b, Dubois/Poitou 2002. [zurück]
8 Um jede Ambiguität zu vermeiden, nennen wir "Flexionsklasse" eine Kategorie, die mit Flexionsmerkmalen definiert ist und verwenden den Begriff "Kategorie" für Mengen von Elementen, die mit lexikalischen (außermorphologischen) Eigenschaften definiert sind. [zurück]
9 Substantive wie "Glaube", "Name", usw. gehören nicht (nicht mehr!) zu dieser Flexionsklasse wegen ihrer Gen.Sing.-Form auf -ens (Glaubens, Namens, usw.). Zum Sonderfall "Hode", s. weiter unten. [zurück]
10 Nach den Aussprachewörterbüchern gilt Penultimabetonung für beide Formen: 'Augur, Au'guren. [zurück]
11 Zum Beispiel kommt "des Mensch" (als echte Gen.-Form) in den von Google registrierten deutschsprachigen Web-Seiten öfter vor als "des Menschs". - Für alle globalen quantitativen Analysen stützen wir uns auf die Suchmaschine Google. Dieses Verfahren hat einen Vorteil (die Quantität der verfügbaren Daten) und einen Nachteil: Eine Wortverbindung wie "des soldats" kommt z.B. auf deutschsprachigen Seiten oft vor, ist aber ein Zitat aus dem Französischen und keine (fehlerhafte) Genitiv-Form. Da die Überprüfung jedes einzelnen Belegs allzu zeitaufwändig wäre und da es uns sowieso nur um grobe quantitative Verhätnisse geht, versuchen wir der Gefahr verzerrter quantitativer Daten dadurch zu entgehen, dass (a) wir nie eine einzelne Substantivform eingeben, sondern die Kombination "Definitartikel + Substantiv", (b) einige Wortverbindungen ausschließen (Beispiel: des soldats), (c) einzelne Seiten stichprobenweise überprüfen. [zurück]
12 Z.B. ist die schwache Pluralform von "Diamant" (Diamanten) etwa hundertmal häufiger belegt als die starke (Diamant), während "Diamants" als Genitivform ein Viertel der Gen.-Sing.-Belege ausmacht. [zurück]
13 Nur gehen nicht alle Wörter auf -ant auf ehemalige schwache Maskulina zurück. Z.B. steht für "Proviant" im Grimmschen Wörterbuch kein einziger Beleg einer mask. schwachen Form. Ein Wort wie "Krokant", das aus dem Französischen kommt, schwankt zwischen Mask. und Neutr. und ist nur mit starken Formen belegt. [zurück]
14 Im Fall von "Niss" scheint die Entwicklung erst im letzten Jahrhundert zum Abschluss gekommen zu sein: Während bei Grimm und Paul (immerhin 9. Auflage 1992) "Niss" und "Nisse" als Grundform nebeneinander stehen, findet sich auf den von Google registrierten Web-Seiten kein einziger Beleg für "die Niss". - Daneben nennt Augst (1975: 41) 8 Substantive mit e-Plural, die feminin sein können (Kimm, Spring, Wittib, Pier, Hulk/Holk, Kuff, Luck und Phlox). Sie scheinen aber alle zu schwanken, sowohl im Genus als auch in der Pluralform. [zurück]
15 Wir verzichten auf die Auflistung aller Reihen, sofern sie zu keinen weiteren Erkenntnissen führen würde. [zurück]
16 Im Leizpziger online-Wörterbuch (http://www.wortschatz.uni-leipzig.de/index_js.html) findet sich kein Beleg für "Verdrusse", Google verweist auf zwei Seiten mit "die Verdrusse". [zurück]
17 Mit dieser Nummerierung meinen wir natürlich nicht den Anfang der Geschichte. Der er-Plural geht bekanntlich auf ein stammbildendes Suffix zurück, das in allen Formen des Paradigmas vorkam, im Singular aber abgebaut wurde und infolgedessen als Pluralsuffix reanalysiert wurde. [zurück]
Literaturangaben
Augst, Gerhard (1975): Untersuchungen zum Morpheminventar der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen. (= Forschungsberichte des Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim 25).
Bittner, Dagmar (1991): Von starken Feminina und schwachen Maskulina. Die neuhochdeutsche Substantivflexion. - Eine Systemanalyse im Rahmen der natürlichen Morphologie. Dissertation (A). Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Bojunga, Klaudius (1890): Die Entwicklung der nhd. Substantivflexion in ihrem inneren Zusammenhang in Umrissen dargestellt. Leipzig.
Bybee Joan L./Moder, Carol Lynn (1983): "Morphological Classes as Natural Categories". Language 59, 2: 251-270.
Bybee, Joan L. (1985): Morphology. A study of the relation between meaning and form. Amsterdam/Philadelphia. (= Typological Studies in Language 9)
Bybee, Joan L. (1988): "Morphology As Lexical Organization". In: Hammond, Michael/ Noonan, Michale (eds.): Theoretical Morphology. Approaches in Modern Linguistics. San Diego/New York et al.: 119-141.
Dubois, Danièle (ed.) (1991): Sémantique et cognition. Catégories, prototypes, typicalité. Paris: 225-244.
Dubois, Danièle/Poitou, Jacques (2002): "Des 'normes catégorielles': structuration cognitive et/ou linguistique des catégories sémantiques". Intellectica 2002/2, 35: 217-249.
Grimm, Jakob/ Grimm, Wilhelm (1984): Deutsches Wörterbuch. 33 Bände. München.
Gürtler, Hans (1912-13): "Zur Geschichte der deutschen er-Plurale, besonders im Frühneuhochdeutschen." Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 37 (1912): 492-542; 38 (1913): 67-224
Kleiber, Georges (1990): La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical. Paris.
Köpcke, Klaus-Michael (1993): Schemata bei der Pluralbildung im Deutschen. Versuch einer kognitiven Morphologie. Tübingen. (= Studien zur deutschen Grammatik 47).
Köpcke, Klaus-Michael (1995): "Die Klassifikation der schwachen Maskulina in der deutschen Gegenwartssprache." Zeitschrift für Sprachwissenschaft 14, 2: 159-180.
Köpcke, Klaus-Michael (2000): "Chaos und Ordnung - Zur semantischen Remotivierung einer Deklinationsklasse im Übergang vom Mhd. zum Nhd.". In: Bittner, A./Bittner, D./ Köpcke, K.-M. (eds): Angemessene Strukturen: Systemorganisation in Phonologie, Morphologie und Syntax. Hildesheim/Zürich/New York: 107-122.
Mangasser-Wahl, Martina (ed.), 2000: Prototypentheorie in der Linguistik. Anwendungsbeispiele - Methodenreflexion - Perspektiven. Tübingen.
Paul, Hermann (19375): Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle.
Paul, Hermann (19929): Deutsches Wörterbuch. Tübingen.
Poitou, Jacques/Dubois, Danièle (1999): "Catégories sémantiques et cognitives. Une étude expérimentale en sémantique lexicale." Cahiers de Lexicologie 74 (1999-1): 5-27.
Poitou, Jacques (1990): "Zur Existenzberechtigung der Ausnahmen." Linguistische Studien 208: 109-118.
Poitou, Jacques (1992): Hétérogénéité et motivation en morphologie flexionnelle. La flexion substantivale allemande. 2 volumes. Thèse pour le Doctorat d'Etat. Université de Paris-VIII.
Poitou, Jacques (1997): "Régularité, analyses quantitatives et productivité: quelques remarques." Silexicales 1: 221-230. (= Mots possibles et mots existants. Forum de morphologie (1ères rencontres). Actes du colloque de Villeneuve d’Ascq (28-29 avril 1997).)
Poitou, Jacques (2000a): "Conceptions prototypiques et articulation du changement diachronique." TRANEL 34-35: 85-99.
Poitou, Jacques (2000b): "Prototypes, saillance et typicalité." Nouvelles terminologies 21: 17-26.
Poitou, Jacques (2003): "Polysémie et catégorisation en chaîne". In: Rémi-Giraud, S./Panier, L. (eds.): La polysémie - Les empires du sens. Lyon: 29-38.
Rosch, Eleanor H. (1973): "Natural Categories". Cognitive Psychology 7: 573-605.
Rosch, Eleanor H. (1975): "Cognitive Representations of Semantic Categories." Journal of Experimental Psychology 104 (1975), 3: 192-233.
Taylor, John R. (19952): Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford.
Wurzel, Wolfgang Ullrich (1984): Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Ein Beitrag zur morphologischen Theoriebildung. Berlin. (= Studia Grammatica XXI).
Wurzel, Wolfgang Ullrich (1988): "Analogie: Hermann Paul und die natürliche Morphologie." Zeitschrift für Germanistik 5: 537-544.
Wurzel, Wolfgang Ullrich (1994): "Gibt es im Deutschen noch eine einheitliche Substantivflexion? oder: Auf welche Weise ist die deutsche Substantivflexion möglichst angemessen zu erfassen?". In: Köpcke, K.-M. (ed.): Funktionale Untersuchungen zur deutschen Nominal- und Verbalmorphologie. Tübingen: 29-42.